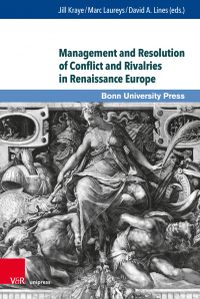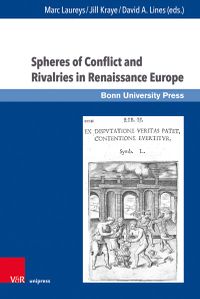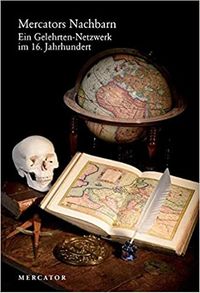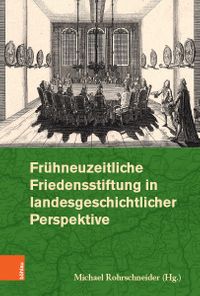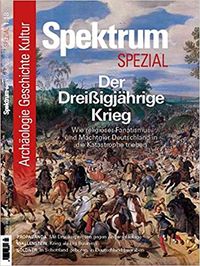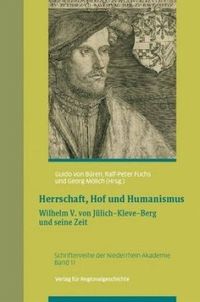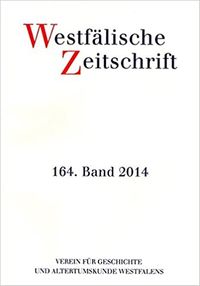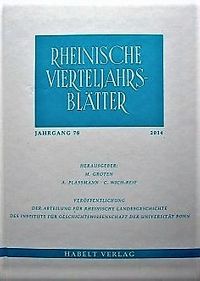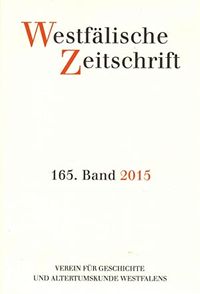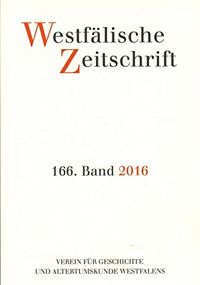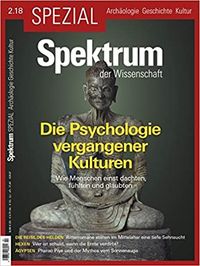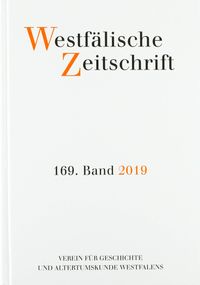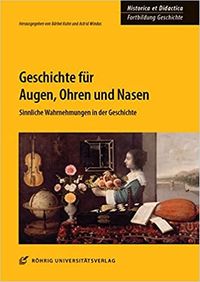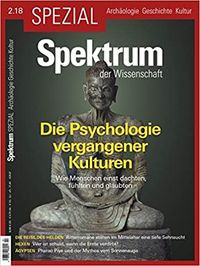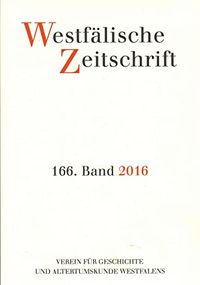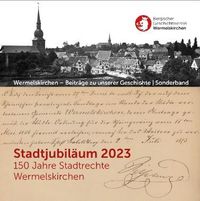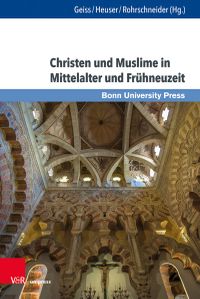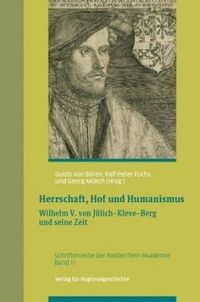Aktuelles
Link:
Peter Arnold Heuser: Laufende Arbeiten zur historischen Friedens-, Konflikt- und Gewaltforschung (Stand: 15. März 2024).
Zum Ausdrucken:
I.
Save the date
- 14. Oktober 2025, Vortrag: Zwischen Ordalienmentalität und experimentellem Denken. Hexenproben (Wasserprobe, Stigmaprobe) im frühneuzeitlichen Kurfürstentum Köln als historische Erkenntnisquellen. Veranstalter: Wissenschaftlicher Verein Mönchengladbach, Dienstag, 14. Oktober 2025, 19.00 – 21.00 Uhr. Ort: Haus Erholung, Johann-Peter-Bölling-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
- 28. Oktober 2025, Vortrag: Hexenjustiz im Kurfürstentum Köln. Konjunkturen, Strukturen und Akteure. Veranstalter: VHS Datteln, Dienstag, 28. Oktober 2025. Ort: Bücherei Bücherwurm, Datteln, 19.00 Uhr – 21 Uhr.
II.
Neuigkeiten ab 2022
- 29. April 2022: Wahl zum ordentlichen Mitglied der Historischen Kommission für Westfalen.
- 3. Januar 2023: In Ergänzung zu Band 33 der Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte (s.u. Kap. III.1.A) schaltet die Universitätsbibliothek Rostock ein Volltext-Digitalisat der Hausbibel Quistorp frei (Goslar, Johannes Voigt, 1614/15), dazu den Anhang Lose Blätter zur Quistorpschen Familienbibel.
- Ausgewählte Papers stehen seit April 2023 im Portal Academia.edu zur Ansicht oder zum "Download" bereit: https://independent.academia.edu/PeterArnoldHeuser.
- 15. Februar 2024: Im Auftrag der Presses universitaires de Franche-Comté der Universität Besançon wird online freigeschaltet: HEUSER, Peter Arnold: Jean Matal (vers 1517-1597), humaniste iréniste d’origine comtoise aux Pays-Bas et en Basse-Rhénanie, in: Laurence Delobette, Paul Delsalle (Hgg.), La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, XIIIe-XVIIIe siècles, Tome 1: Aspects politiques, diplomatiques, religieux et artistiques (Actes du colloque international Vesoul, 25 octobre 2006 – Tournai, 26-27 octobre 2006), Besançon 2009 (Cahiers de la MSHE Ledoux 15, Série « Transmission et identités » 5), S. 147-171. Link: DOI: https://doi.org/10.4000/books.pufc.24717.
- Ab 1. Oktober 2024: Research Associate am Centre for the Classical Tradition (CCT) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (https://www.cct.uni-bonn.de), Rabinstraße 8, 53111 Bonn, Deutschland, Email: paheuser@uni-bonn.de, Tel.: +49/(0)151/68501587.
- Neuer Podcast: 5. Dezember 2024, 9.45 - 10.00 Uhr, WDR 5, Reihe "Zeitzeichen": 5. Dezember 1484, Ausfertigung der "Hexenbulle" Papst Innozenz' VIII. Link: https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/320/3207373/3207373_60246367.mp3.
III.
Publikationen: Neuerscheinungen ab 2020
(nach Arbeitsfeldern)
III.1 Arbeitsfeld Universitätsgeschichte, Bildungsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte
A. Bücher:
Peter Arnold Heuser: Die Rostocker Theologen Quistorp des 17. und 18. Jahrhunderts im Spiegel ihrer Familienbibel. Kommentierte Edition einer Quelle zur Memorialkultur einer lutherischen 'Universitätsfamilie' der Frühen Neuzeit (= Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte, Bd. 33), Rostock 2021 (UNI Rostock: ISBN 978-3-86009-359-7; Herausgeber: Rektor der Universität Rostock; Redaktion: Kersten Krüger; 388 Seiten). Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Quistorp-Stiftung, Rostock, im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.; Geleitwort: Alexandra von der Wenge Gräfin Lambsdorff, geb. von Quistorp, als Vorsitzende des Kuratoriums der Quistorp-Stiftung, Rostock. - Elektronische Ressource (der Volltext ist kostenfrei zugänglich ohne Registrierung): https://doi.org/10.18453/rosdok_id00003108. - Eine textgleiche Printausgabe (ISBN 978-3-940835-68-0) für den Buchhandel ist am 27. September 2021 im ß-Verlag & Medien GbR, Rostock, erschienen (https://d-nb.info/1240322429). - S. dazu die Rezensionen von Hermann-Peter Eberlein in: Jahrbuch für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 72 (2023), S. 234-236; Corinna Ehlers in: Revue d'histoire ecclésiastique 119 (2024), 1/2, S. 411-414.
III.2 Arbeitsfeld Historische Friedens- und Konfliktforschung, Historische Gewaltforschung
s. auch Kap. III.3: Arbeitsfeld Historische Kriminalitätsforschung, Geschichte der Hexenverfolgungen in der europäischen Frühneuzeit
A. Bücher:
A.1. Peter Geiss, Peter Arnold Heuser, Michael Rohrschneider (Hgg.): Christen und Muslime in Mittelalter und Frühneuzeit. Ein Schlüsselthema des Geschichtsunterrichts im transepochalen Fokus (= Wissenschaft und Lehrerbildung, Bd. 7), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht, V&R unipress, Bonn University Press) 2022. ISBN: 978-3-8471-1365-2; https://d-nb.info/1236110579. - E-Book: ISBN: 978-3-8470-1365-5; ISBN: 978-3-7370-1365-9.
Inhalt: "Die Beziehungsgeschichte von Christen und Muslimen war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit äußerst vielschichtig, woraus sich besondere Anforderungen für das historische Lernen ergeben. Dieser Band will das Erkenntnispotenzial erschließen, das in einer Historisierung von Religion als Faktor des menschlichen Zusammenlebens - sei es friedlich oder konfliktreich - in der Geschichte liegt. Ausgehend vom aktuellen Kernlehrplan Geschichte (Sekundarstufe II) in Nordrhein-Westfalen, sollen Lehrkräfte Informationsgrundlagen und Anregungen dazu erhalten, wie das überaus anspruchsvolle Themenfeld »Christen und Muslime in Mittelalter und Frühneuzeit« in fachlich fundierter und zugleich motivierender Weise unterrichtet werden kann. Das Buch wendet sich darüber hinaus an all jene Leserinnen und Leser, die sich in und außerhalb der Schule mit Grundlagen und Vermittlungsfragen christlich-muslimischer Geschichte befassen möchten. Der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser wechselvollen Geschichte kommt eine zentrale Bedeutung für Toleranz, Respekt und Freiheit in pluralen Gesellschaften der Gegenwart zu." (Cover-Text)
Eigene Beiträge:
- Peter Geiss, Peter Arnold Heuser, Michael Rohrschneider: Einleitung: Christen und Muslime in Mittelalter und Frühneuzeit - Herausforderungen und Bedeutung des Themenfeldes im historischen Lernen, in: ebd., S. 7-20.
- Peter Arnold Heuser: Religion und Konfession als Dimensionen einer historischen Friedens- und Konfliktforschung - Anmerkungen zu einem ambivalenten Aspekt islamisch-christlicher Kulturbegegnung in Geschichte und Gegenwart, in: ebd., S. 103-126.
Rezensionen:
- Christian Mühling (Institut für Geschichte, UNI Würzburg), in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 133 (2022), Heft 3, S. 406ff; Görge K. Hasselhoff (Institut für Ev. Theologie, TU Dortmund), in: sehepunkte 24 (2024), Nr. 5 [15.05.2024]; Link: https://www.sehepunkte.de/2024/05/druckfassung/36829.html; Anna Gili, in: Medioevo latino 45 (2024), S. 1007; Maria Teresa Börner (Guardini-Stiftung e.V., Berlin), in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 86 (2023), Heft 3, S. 769-774.
A.2. Peter Geiss, Peter Arnold Heuser (Hgg.): Friedensordnungen in geschichtswissenschaftlicher und geschichtsdidaktischer Perspektive (= Wissenschaft und Lehrerbildung, Bd. 2), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht, V&R unipress, Bonn University Press) 2017. ISBN: 978-3-8471-0671-5. - E-Book: ISBN: 978-3-8470-0671-8. - Als e-Book verfügbar unter https://doi.org/10.14220/9783737006712.
Hinweis: Im Sommer 2021 wurde die Print-Ausgabe ISBN: 978-3-8471-0671-5 als elektronische Reproduktion auf bonndoc, dem Publikationsserver der Universität Bonn, freigeschaltet und ist damit im Volltext kostenfrei und ohne Registrierung benutzbar: https://hdl.handle.net/20.500.11811/8954.
Inhalt: "Der Tagungsband studiert Friedensordnungen vom 16. bis ins frühe 21. Jahrhundert. Die Autoren beleuchten Probleme von hoher Gegenwartsrelevanz, darunter die Frage nach einem gewaltfreien Umgang mit religiöser Differenz, auf die Friedenspolitik bereits im 16. und 17. Jahrhundert beachtenswerte Antworten fand, oder die friedenspolitischen Herausforderungen, die sich aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ergeben. Mit historischer Langzeitperspektive studieren die Beiträger Praktiken und Leitbegriffe der Aushandlung von Frieden, Strategien der Friedenssicherung im historischen Wandel sowie den ideengeschichtlichen Diskurs, der sich etwa in den Friedensutopien der Frühen Neuzeit niederschlug. Angeregt durch den neuen Oberstufen-Lehrplan für das Fach Geschichte in Nordrhein-Westfalen, wendet sich der Band an Lehrer und Lehrerinnen, an die geschichtswissenschaftliche und geschichtsdidaktische Forschung sowie an eine Leserschaft, die sich für Fragestellungen, aktuelle Tendenzen und Perspektiven einer Historischen Friedensforschung interessiert." (Cover-Text)
Eigene Beiträge:
- Peter Geiss, Peter Arnold Heuser: Einleitung, in: Geiss / Heuser, Friedensordnungen (wie vorstehend), S. 13-25.
- Peter Arnold Heuser: Vom Augsburger Religionsfrieden (1555) zur konfessionellen Friedensordnung des Westfälischen Friedens (1648), in: Geiss / Heuser, Friedensordnungen (wie vorstehend), S. 47-68.
Rezensionen:
- Jan Ole Wiechmann für den Arbeitskreis Historische Friedens- und Konfliktforschung, in: H-Soz-Kult, 26.04.2018; Link: https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-28045.
- Peter Lautzas, in: Geschichte für heute. Zeitschrift für historisch-politische Bildung 11 (2018), Heft 4, S. 103-105.
Volltext (kostenfrei, freigeschaltet 2021):
https://hdl.handle.net/20.500.11811/8954.
B. Aufsätze und Buchbeiträge:
Peter Arnold Heuser: Conflict Management and Resolution at the Peace Congress of Westphalia 1643–1649, in: Jill Kraye, Marc Laureys, David A. Lines (Hgg.): Management and Resolution of Conflict and Rivalries in Renaissance Europe (= Super alta perennis. Studien zur Wirkung der Klassischen Antike, Bd. 25), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht, V&R unipress, Bonn University Press, 1. Edition) 2023, S. 51-75; Preis: 55,00 Euro; ISBN: 978-3-8471-0628-9; Sprache: Englisch, 313 Seiten, mit 34 Abbildungen, gebunden). Link: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/detail/index/sArticle/58338.
Abstract: "In any peace negotiation, the substance of the peace proposals is not the only key to a successful resolution of conflicts, but also their appropriate timing within the peace process. Inspired by the theory of ripeness used in peace and conflict studies following Ira William Zartman, Section 1 (= The Westphalian Peace Congress 1643–1649: Timing and Shaping of a European Peace Process) reassesses the Westphalian Peace Congress 1643–1649 as an example for the impact of military stalemate (and of the changing cost-benefit-ratios of the parties involved) on conflict settlement in early modern history. Section 2 (= ‘Media ad pacem’: Conflict Management and Resolution at the Westphalian Peace Congress 1643–1649) provides a brief overview of the most important media ad pacem implemented by actors at the level of congress management and of the final peace treaties, taking into account the guiding principles of general amnesty and restitution, the direct and indirect forms of negotiation that the congress established, and religious peace as an integral part of the Peace of Westphalia (24 October 1648)."
Description of the volume: "This is the third and final volume of essays issuing from the Leverhulme International Network ‘Renaissance Conflict and Rivalries: Cultural Polemics in Europe, c. 1300–c. 1650’. The overall aim of the network was to examine the various ways in which conflict and rivalries made a positive contribution to cultural production and change during the Renaissance. The present volume, which contains papers delivered at the third colloquium in 2015, draws that examination to a close by considering a range of different strategies deployed in the period to manage conflict and rivalries and to bring them to a positive resolution. The papers explore these developments in the context of political, diplomatic, social, institutional, religious, and art history." (V&R)
- Dr. Jill KRAYE ist Emeritus Professor of the History of Renaissance Philosophy an der University of London und Honorary Fellow am Warburg Institute.
- Dr. Marc LAUREYS ist Professor für Mittel- und Neulateinische Philologie an der Universität Bonn und Sprecher des Bonner Centre for the Classical Tradition.
- Dr. David A. LINES (Reader, Italian Studies, Universität Warwick) erforscht v.a. die Philosophie der Renaissance. Er leitet das Leverhulme International Network über ›Renaissance Conflict and Rivalries‹ und ist Mitglied des Centre for the Study of the Renaissance in Warwick.
Peter Arnold Heuser: The Westphalian Peace Congress 1643-1649 as a Sphere of Conflict and Rivalries, in: Marc Laureys, Jill Kraye, David A. Lines (Hgg.): Spheres of Conflict and Rivalries in Renaissance Europe (= Super alta perennis. Studien zur Wirkung der Klassischen Antike, Bd. 22), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht, V&R unipress, Bonn University Press) 2020, S. 257-277.
Abstract: "In the Westphalian cities of Münster and Osnabrück, the Peace Congress of Westphalia worked out a series of peace treaties signed in 1648. These treaties ended the Eighty Years’ War (1568–1648) between Spain and the emerging Dutch Republic, and the Thirty Years’ War (1618–1648) in the Holy Roman Empire. They established the independence of Switzerland from the Empire and changed the system of political order in Europe. For nearly half a decade, between 1643 and March 1649, the congress brought together a total of nearly 300 envoys (ambassadors, residents, agents), representing European powers and Imperial estates of different size and political importance. Their peace negociations and their interactions constituted a distinct sphere of diplomatic conflicts and rivalries, with complex external relations to the European capitals, to political leaders and political factions in different parts of Europe. This contribution sketches a typology of these conflicts and rivalries, depicts the forms of reporting, communication and media the actors used, describes how their intellectual backgrounds influenced their “Streitkultur” and deals with the techniques that the congress developed to overcome or at least to neutralize conflicts and rivalries in favour of an overall peace agreement."
Description of the volume: "This volume is devoted to the spheres in which conflict and rivalries unfolded during the Renaissance and how these social, cultural and geographical settings conditioned the polemics themselves. This is the second of three volumes on ‘Renaissance Conflict and Rivalries’, which together present the results of research pursued in an International Leverhulme Network. The underlying assumption of the essays in this volume is that conflict and rivalries took place in the public sphere that cannot be understood as single, all-inclusive and universally accessible, but needs rather to be seen as a conglomerate of segments of the public sphere, depending on the persons and the settings involved. The articles collected here address various questions concerning the construction of different segments of the public sphere in Renaissance conflict and rivalries, as well as the communication processes that went on in these spaces to initiate, control and resolve polemical exchanges." (V&R)
Peter Arnold Heuser: Das Intellektuellen-Netzwerk um Gerhard Mercator: eine Aufgabe für Forschung und Gedenkkultur, in: Andrea Gropp (Red.): Mercators Nachbarn: Ein Gelehrten-Netzwerk im 16. Jahrhundert, Duisburg (Mercator-Verlag) 2020, S. 142-175. – Der Band ist zugleich Katalog zur Ausstellung: Geister & Genies. Ein Duisburger Gelehrten-Netzwerk im 16. Jahrhundert, 20. Juni 2021 bis 9. Januar 2022, Kultur- und Stadthistorisches Museum Duisburg.
Peter Arnold Heuser: Ideengeschichtliche Dimensionen humanistischer Politikberatung. Jean Matal, Pedro Ximénez und der Kölner Friedenskongress ("Pazifikationstag") 1579, in: Michael Rohrschneider (Hg.): Frühneuzeitliche Friedensstiftung in landesgeschichtlicher Perspektive (= Rheinisches Archiv, Bd. 160), Wien - Köln - Weimar (Böhlau-Verlag) 2020, S. 119-136.
Peter Arnold Heuser: Westfälischer Frieden, in: Spektrum der Wissenschaft Spezial. Archäologie - Geschichte - Kultur, Heft 1 (2018): Der Dreißigjährige Krieg, S. 74-81.
Peter Arnold Heuser: Netzwerke des Humanismus im Rheinland: Georgius Cassander (1513-1566) und der jülich-klevische Territorienverbund, in: Guido von Büren, Ralf-Peter Fuchs und Georg Mölich (Hgg.): Herrschaft, Hof und Humanismus. Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg und seine Zeit (= Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie, Bd. 11), Bielefeld (Verlag für Regionalgeschichte) 2018 (2. Auflage 2020), S. 501-530.
Stichwörter zum Inhalt: Renaissancehumanismus, Irenik, Desiderius Erasmus von Rotterdam, "Erasmianer", Brügge, Gent, Löwen, Antwerpen, Augustinismus, Bajanismus, italienischer Evangelismus, Juan de Valdés, Reginald Pole, humanistische Jurisprudenz, Ulrich Zasius, Andrea Alciato, Friedensidee, Friedenshoffnung, Friedenssemantiken, Friedensfähigkeit, humanistische Politikberatung (Kaiserhof, Kaiser Ferdinand I., Kaiser Maximilian II., Kurfürstentum Köln, Fürstbistum Münster, Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, Grafen von Neuenahr-Moers, reichsfreie Stadt Köln, Frankreich: Kolloquium von Poissy 1561), Schulhumanismus, Akademisches Gymnasium Duisburg, Universität Duisburg, Patristik, Liturgik, Hymnologie, Humanistische Philologie, Quellenkritik, Hermeneutik, Geschichte der Geschichtswissenschaft, Konfessionsbildung, Kirchenspaltung, Reconciliatio, Wiedervereinigung der Konfessionen, Konkordie, kirchliche Unionsbestrebungen, konfessionelle Ambiguität, binnenkonfessionelle Pluralität, Interkonfessionalität, Transkonfessionalität, Gewissensfreiheit, Toleranz, Widerstand, Exil, Kirchenordnungen Jülich-Kleve, Cornelius Wouters, Jean Matal (Ioannes Matalius Metellus Sequanus), Pedro Ximénez (Petrus Ximenius), Fadrique Furió Ceriol, Aggaeus van Albada, Karel Utenhove d.Ä., Karel Utenhove d.J., Gerhard Mercator, Johann Otho, Andreas Dudith Sbardellat, Mario Salamonio, Hubert Languet, Philippe du Plessis-Mornay, George Buchanan, Daniel Prinz, politische Theorie, Monarchomachen, Vindiciae contra tyrannos (1579), Kölner Friedenskongress (Pazifikationstag) 1579; Rezeptionsgeschichte Cassanders: Jean Hotman, Jacques-Auguste de Thou, Jean de Cordes und die Pariser Werkausgabe Cassanders von 1616; Petrus Bertius, Daniel Heinsius, Hugo Grotius und die Cassander-Rezeption durch die niederländischen Remonstranten; die Cassander-Rezeption während der englischen Bürgerkriege des 17. Jahrhunderts; Johannes Saubert d.Ä. in Nürnberg; Helmstedt: Hermann Conring, Georg Calixt, Johannes Latermann; Gottfried Wilhelm Leibniz; Joachim Schröder in Rostock; Gottfried Arnold; Aufklärung: Christian Thomasius, Pieter Burman d.Ä.; Febronianer; Historisierung: Cassander in den Enzyklopädien und Lexika, in Geschichtsschreibung und Kirchengeschichte. - Rezensionen: Sebastian Schröder, in: Westfälische Forschungen 68 (2018), S. 575-478; Sabine Arend, in: sehepunkte 18, 2018, Nr. 12 [15.12.2018]; Link: http://www.sehepunkte.de/2018/12/31557.html.
C. Filmografie
- 1648 - Der lange Weg zum Frieden. Wie der Dreißigjährige Krieg beendet wurde. Deutsch-französisch-tschechisch-belgische Koproduktion (ARTE, WDR, CT, RTBF). Doku-Drama, 90 Min., mit Rüdiger Vogler, Axel Wandtke u.a. Regie und Buch: Holger Preuße. Drehbuch: Simone Kollmorgen. Regie (Reenactment): Peter Wekwerth. Redaktion: Beate Schlanstein, Thomas Kamp (WDR). Produzent: Stefan Pannen. Darin Sequenzen zur politischen Publizistik im Achtzigjährigen Krieg, im Dreißigjährigen Krieg sowie im Umfeld des Westfälischen Friedenskongresses. Drehort: Museum Plantin-Moretus, Antwerpen; unter Mitwirkung von Peter Arnold Heuser, Steven van Impe, Toon Krijnen. - Link zum Trailer. - Sendetermine (u.a.): So., 21. Oktober 2018, 14.00 - 15.30 Uhr auf ARTE; Di., 23. Oktober 2018, 9.35 Uhr auf ARTE; Mi., 24. Oktober 2018, 23.20 Uhr auf WDR; Sa., 9. März 2019, 20.15 Uhr auf ARTE. - Die englische Fassung 1648 - The Long Road to Peace wurde von der DEUTSCHEN WELLE (DW) am 24. Oktober 2018, 18.15 Uhr (part 1), und am 31. Oktober 2018, 18.15 Uhr (part 2) gezeigt.
III.3 Arbeitsfeld Historische Kriminalitätsforschung, Geschichte der Hexenverfolgungen in der europäischen Frühneuzeit
s. auch Kap. III.2: Arbeitsfeld Historische Friedens- und Konfliktforschung, Historische Gewaltforschung
Forschungsprojekt Hexenjustiz im Kurfürstentum Köln (um 1500 - um 1730). Studien zur Staatlichkeit des Kurfürstentums Köln in der Frühen Neuzeit. Fortsetzung der seit 1998 laufenden und bis 2030 terminierten Publikationsreihe zu den juristischen, administrativen und institutionellen, den prosopografischen und soziologischen, den religiösen, theologischen, frömmigkeitsgeschichtlichen und volkskundlichen, den medizinischen und sinnesgeschichtlichen, den wissenschaftsgeschichtlichen und ideengeschichtlichen Dimensionen und Rahmenbedingungen peinlichen Strafens im Kurfürstentum Köln der Frühen Neuzeit, mit einem besonderen Fokus auf den Hexenverfolgungen des 16. und 17. Jahrhunderts in den kurkölnischen Teilterritorien am Rhein und in Westfalen sowie den häuslichen und innergesellschaftlichen Konflikten, die sich mit ihnen verbanden.
A. Neueste Publikation:
Peter Arnold Heuser: Die Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit im kurkölnischen Herzogtum Westfalen. Konjunkturen, Strukturen und Akteure, in: Oliver R. Schmidt, Ulrike Schowe, Niels Reidel (Hgg.): Du Hexe! Opfer und ihre Häscher, Katalog zur Ausstellung im Sauerland-Museum. Museum und Kulturforum Südwestfalen, Arnsberg, 24. März bis 4. September 2022, S. 10-21.
B. Publikationen ab 2014:
Peter Arnold Heuser und Rainer Decker: Die theologische Fakultät der Universität Köln und die Hexenverfolgung. Die Hexenprozess-Instruktion (1634) des Arnsberger Juristen Dr. Heinrich von Schultheiß im Spiegel eines Fakultätsgutachtens von 1643, in: Westfälische Zeitschrift 164 (2014), S. 171-219. - Text online unter: http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/wz-11007.pdf. - Inhalt: Einleitung; Kap. 1: Vorgeschichte: Vom 'Malleus maleficarum' des Dominikaners Heinrich Institoris 1487 bis zur 'Cautio criminalis' des Jesuiten Friedrich Spee 1631 [darin S. 177-187 Publikation wichtiger Quellen-Neufunde zur Frührezeption der 'Cautio criminalis' im kurkölnischen Hofrat, bei Weihbischof, Offizial und Generalvikar ab dem 5. Juli 1631]; Kap. 2: Das Gutachten der theologischen Fakultät der Universität Köln vom 30. Mai/7. Juni 1643 über die Hexenprozessinstruktion des Dr. jur. utr. Heinrich von Schultheiß aus dem Jahre 1634; Kap. 2.1: Edition (Lateinische Textfassung; Zeitgenössische Übersetzung); Kap. 2.2: Anlass; Kap. 2.3: Interpretation; Kap. 2.4: Rezeptionsgeschichte; Bewertung.
Peter Arnold Heuser: Der Rostocker Jurist Johann Georg Gödelmann (1559-1611) und die kurkölnische Hexenordnung vom 24. Juli 1607. Studien zur kurkölnischen Hexenordnung, Teil I: Entstehungsgeschichte und Textgenese bis 1607, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 78 (2014), S. 84-127. - Text online unter: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/periodical/pageview/6130856. - Inhalt: Einleitung; Kap. 1: Die kurkölnische Hexenprozessordnung vom 24. Juli 1607. Ein Textauszug aus dem dritten Buch des "Tractatus de magis, veneficis et lamiis" des Rostocker Juristen Johann Georg Gödelmann (1559-1611); Kap. 1.1: Edition; Kap. 1.2: Textbefund; Kap. 2: Interpretation und Einordnung; Kap. 2.1: Zur Entstehungsgeschichte der kurkölnischen Hexenordnung (1604-1607); Kap. 2.2: Die kurkölnische Hexenordnung von 1607 als Dokument eines Generationswechsels im kurkölnischen Hofrat; Schluss.
Peter Arnold Heuser: Die kurkölnische Hexenprozessordnung von 1607 und die Kostenordnung von 1628. Studien zur kurkölnischen Hexenordnung, Teil II: Verbreitung und Rezeption, in: Westfälische Zeitschrift 165 (2015), S. 181-256. - Auslieferung: Januar 2016. - Inhalt: Kap. 1: Vor- und Entstehungsgeschichte der kurkölnischen Hexenordnung (1592-1607); Kap. 2: Die Hexenordnung von 1607: Verbreitung im Territorium, regierungsamtliche Auslegungen, Zusätze und Ergänzungen, regierungsamtliche Überprüfungen 1651-1653 und 1696; Kap. 3: Die Hexenordnung quoad expensas (Kostenordnung) von 1628: Vorgeschichte, Entstehung, juristischer und administrativer Stellenwert, Befristung und Geltungsvorbehalt, Fortgeltung der lokalen Gerichtsweistümer, Wirkungsgeschichte; Kap. 4: Offiziöse Prozessanleitungen; Editorischer Anhang: 1. Die kurkölnische Kostenordnung für Hexenprozesse vom 27. November 1628; 2. Die Hexenprozessrichtlinie der Kölner Hochgerichtsschöffen Dr. jur. Walram Blanckenberg und Dr. jur. Johann Romeswinckel für die Vogtei Ahrweiler, mit kurfürstlicher Approbation vom 4. Mai 1629. - Text online unter: http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/wz-11687.pdf.
Peter Arnold Heuser: Die Nadelprobe (Stigmaprobe) in kurkölnischen Hexenprozessen. Studien zur Kontroverse zwischen Peter Ostermann und Johannes Jordanaeus (1629-1630), in: Westfälische Zeitschrift 166 (2016), S. 213-266. - Inhalt: Kap. 1: Einleitung: Heinrich von Schultheiß, Peter Ostermann und die Nadelprobe 1634; Kap. 2: Studien zur Ostermann-Jordanaeus-Kontroverse um die Nutzung der Stigmaprobe im Hexenprozess, 1629-1630; Kap. 2.1: Der Commentarius iuridicus ad l. stigmata, c. de fabricensibus des Juristen Peter Ostermann (Köln 1629); Kap. 2.2: Die Disputatio brevis et categorica de proba stigmatica (Köln 1630) des Theologen Johannes Jordanaeus; Kap. 2.3: Die anonyme Defensio probae stigmaticae et magistratuum (um 1630/31) und ihre Anhänge; Kap. 3: Zur Wirkungsgeschichte der Ostermann-Jordanaeus-Kontroverse im Kurfürstentum Köln. - Stichwörter zum Inhalt: Hexenglaube und Hexenverfolgung in der europäischen Frühneuzeit; Kurfürstentum Köln (1500-1794); Rheinisches Erzstift; Herzogtum Westfalen; Nadelprobe; Stigmaprobe; Kaltwasserprobe; Hexenproben; Apokalyptisches Denken im konfessionellen Zeitalter; Apokalyptik und Hexenprozess; Wissenschaftsgeschichte; Ideengeschichte; Signaturenlehre; Geschichte des experimentellen Denkens; Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmung; Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und gesellschaftlicher Praxis; Neulateinische Literatur; Akademische Streitkultur; Flugschriftenstreit. - Text online unter: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/wz-11803.pdf.
Peter Arnold Heuser: Juristen in kurkölnischen Hexenprozessen der Frühen Neuzeit. Studien zu Konsultation und Kommission im peinlichen Strafprozess, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 81 (2017), S. 61-117. - Inhalt: Kap. 1: Territoriale Ratsprotokolle als Quellen zur Rekonstruktion frühneuzeitlicher Hexenverfolgungen: Bayern und Kurköln im Vergleich; Kap. 2: Graduierte Juristen als Rechtskonsulenten in kurkölnischen Hexenprozessen. Studien zur Konsultation (Ratsuche) im peinlichen Strafprozess der Frühen Neuzeit; Kap. 3: Studien zur Kommission graduierter Juristen im peinlichen Strafprozess; General- und Spezialkommission; Kap. 4: Versuche einer Reform der Kriminaljustiz bis zum Ende des Kurfürstentums Köln als Versuche einer Herrschaftsintensivierung; Kap. 5: Zeitgenössische Perspektiven Außenstehender auf die peinliche Strafjustiz im Kurfürstentum Köln (Beispiele: Regierung und Landstände der Herzogtümer Jülich und Berg 1631; Friedrich Spee von Langenfeld SJ, Cautio criminalis, 1631); Zusammenfassung und Ausblick: Graduierte Juristen als Akteure in kurkölnischen Zauberei- und Hexenprozessen: Rechtsgrundlagen. - Text online unter: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/periodical/pageview/8332483. - Hinweis: Die Publikation des personengeschichtlichen Teils II der Studie, der die Rechtskonsulenten und Kommissare in kurkölnischen Hexenprozessen gruppenbiografisch (prosopografisch) aufarbeitet und ihre Aktivitäten im Hexenprozess sozial und bildungshistorisch sowie religiös und wissenschaftsgeschichtlich einordnet, folgt.
Peter Arnold Heuser:Hexenjagd. Todesurteil "wegen Verderbung des Korns", in: Spektrum Spezial. Archäologie - Geschichte - Kultur, Heft 2 (2018), Thema: Die Psychologie vergangener Kulturen. Wie Menschen einst dachten, fühlten und glaubten, S. 62-67.
Peter Arnold Heuser: Hermann von Hatzfeldt-Wildenburg-Werther (1527-1600) und die Hexenverfolgungen im Amt Balve. Eine Studie zur peinlichen Strafjustiz im kurkölnischen Herzogtum Westfalen, in: Westfälische Zeitschrift 169 (2019), S. 133-233. - Zum Inhalt: Die Amtmänner oder Drosten, die in den drei Jahrhunderten der Frühen Neuzeit zwischen 1500 und 1800 Amtsbezirke in den rheinischen und westfälischen Teilterritorien des Kurfürstentums Köln verwalteten, rekrutierten sich vornehmlich aus einflussreichen Familien der kurkölnischen Ritterschaften. Im rheinischen Erzstift waren es insbesondere die Familien Beissel von Gymnich, Blankart (von Ahrweiler, Lantershofen und Odenhausen), von dem Bongardt zu Bergerhausen, von Breitbach zu Bürresheim, von Brempt, zu Eltz-Kempenich, von Gymnich, von der Hövelich, von der Leyen zu Saffig, Quadt (zu Buschfeld), Raitz von Frens, Roist von Weers, Schall von Bell zu Lüftelberg und Morenhoven, Scheiffardt von Merode, Spies von Büllesheim, von Tomburg genannt Wormbs, von Virmondt (Viermund) zu Neersen, Waldbott von Bassenheim zu Gudenau, von Weichs und Wolff Metternich zur Gracht, die Amtmänner stellten; im kurkölnischen Vest Recklinghausen die Herren von Nesselrode zu Herten, die Westerholt-Gysenberg und die von der Horst zu Horst. Im kurkölnischen Herzogtum Westfalen kamen die Amtmänner (Drosten) im Zeitalter der Hexenverfolgungen vor allem aus den Familien von Böckenförde genannt Schüngel, Droste zu Erwitte und zu Füchten, Fürstenberg, Hatzfeldt, Hörde, Meschede zu Alme, Landsberg zu Erwitte, Spiegel zum Desenberg und zu Canstein, Weichs zur Wenne und Wrede zu Melschede. Weitere kurkölnische Amtsbezirke waren an Familien der erzstiftischen Grafen- und Herrenbank verpfändet, darunter an die Grafen, gefürsteten Grafen und Herzöge von Arenberg, die Grafen von Isenburg-Grenzau oder die Grafen von Salm.
Ebenso wie die Inhaber der zahlreichen kurkölnischen Unterherrschaften waren auch kurkölnische Amtmänner häufig regionale 'Mehrfachherrscher': teils als Inhaber reichsunmittelbarer Herrschaften, teils als mittelbare Herrschaftsträger, etwa als Unterherren, Pfandherren und Amtmänner, als adlige Räte und Inhaber von Hofämtern im Fürstendienst, teils als einflussreiche Mitglieder landständischer Korporationen nahmen sie zeitgleich in mehreren Territorien des Reiches Einfluss auf die innerterritoriale Verwaltung, die Herrschafts- und die Gerichtspraxis. Ihre Familien- und Verwaltungsarchive, die im Erbgang über weite Teile Europas verstreut wurden, geben Aufschluss über die Praxis frühneuzeitlicher Herrschaft auch im Kurfürstentum Köln.
Im Fokus der Mikrostudie für das Amt Balve des kurkölnischen Herzogtums Westfalen steht der kurkölnische Rat in Westfalen Hermann von Hatzfeldt-Wildenburg-Werther (1527-1600), Samtherr/Kondominatsherr der reichsunmittelbaren Herrschaft Wildenburg an der Sieg, Herr zu Werther in der jülich-klevischen Grafschaft Ravensberg in Ostwestfalen, seit 1589 Inhaber der kurkölnischen Unterherrschaft Schönstein an der Sieg (einer Exklave des rheinischen Erzstifts), als Pfandherr und Amtmann von Balve im kurkölnischen Herzogtum Westfalen von 1561 bis 1600. Auf Basis der Amts- und Gerichtsakten Hermanns im Archiv der Herzöge von Hatzfeldt-Trachenberg im Woiwodschaftsarchiv Wroclaw, im Archiv der Fürsten von Hatzfeldt-Wildenburg auf Schloss Schönstein an der Sieg, im Archiv der Freiherren von Wrede zu Melschede sowie im Gesamtarchiv der Grafen von Landsberg-Velen, zugleich auf der Basis kurkölnischer Regierungsakten, die in den Abteilungen Rheinland und Westfalen des Nordrhein-Westfälischen Landesarchivs in Duisburg und Münster aufbewahrt werden, entsteht ein dichtes, detailreiches Bild vom Einfluss, den Hermann von Hatzfeldt auf die Zauberei- und Hexenverfolgungen in seinen Herrschaften und Amtssprengeln nahm. Seine Korrespondenzen dokumentieren, mit wem er sich über Facetten seines Hexenbildes austauschte und sich über prozesspraktische Fragen beriet, welche graduierten Juristen er als Rechtskonsulenten in Strafprozessen zuließ, welche rechtswissenschaftlichen Einflüsse von außen er bekämpfte, zuließ oder förderte und auf welche Mitarbeiter er sich in seinen Herrschaften und Amtsbezirken stützte. - Link zur Langfassung des Textes, die einen ausführlichen Vergleich zwischen den hochgerichtlichen Handlungsoptionen Hermanns von Hatzfeldt im Pfandamt Balve, der Unterherrschaft Schönstein an der Sieg und der reichsunmittelbaren Samtherrschaft Wildenburg an der Sieg vornimmt: https://www.academia.edu/100446840).
C. Funk und Fernsehen:
- 2. September 2022: WDR 5, Reihe „Neugier genügt“; Feature: Zehntausende Tote: Wie kam es zur Hexenverfolgung?, Autor: Stefan Osterhaus; Redaktion: Jonas Klüter. Link: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/feature-hexenverfolgung-in-westfalen-100.html. Meine Beiträge: Beratung, Teilnahme als Experte und Interviewpartner.
- 5. Dezember 2024, 9.45 - 10.00 Uhr, WDR 5, Reihe "Zeitzeichen": 5. Dezember 1484, Ausfertigung der "Hexenbulle" Papst Innozenz' VIII. Link: https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/320/3207373/3207373_60246367.mp3.
III.4 Arbeitsfeld Historische Wahrnehmungsforschung, Sinnesgeschichte, Historical Perceptology
Peter Arnold Heuser: Der Geruch als Gegenstand historischen Lernens. Beispiele vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, in: Bärbel Kuhn, Astrid Windus (Hgg.): Geschichte für Augen, Ohren und Nasen. Sinnliche Wahrnehmungen in der Geschichte (Historica et Didactica - Fortbildung Geschichte. Ideen und Materialien für Unterricht und Lehre, Bd. 8), St. Ingbert (Röhrig Universitätsverlag) 2016, S. 61-73.
Peter Arnold Heuser: Wahrnehmung. Eine kurze Kulturgeschichte des Riechens, in: Spektrum Spezial. Archäologie - Geschichte - Kultur, Heft 2 (2018), Thema: Die Psychologie vergangener Kulturen. Wie Menschen einst dachten, fühlten und glaubten, S. 78-82.
Peter Arnold Heuser: Hexenjagd. Todesurteil "wegen Verderbung des Korns", in: Spektrum Spezial. Archäologie - Geschichte - Kultur, Heft 2 (2018), S. 62-67.
Peter Arnold Heuser: Eine kurze Kulturgeschichte des Riechens, in: Gehirn & Geist. Zeitschrift für Psychologie und Hirnforschung, Heft 6, 2019, S. 28-33. - Link: https://www.spektrum.de/magazin/der-wandel-des-geruchsempfinden-im-lauf-der-jahrhunderte/1637192.
S. auch Peter Arnold Heuser: Breve historia cultural del olfato, in: Mente y cerebro (ISSN 1695-0887), no. 99 (2019), pags. 86-91.
Peter Arnold Heuser: Die Nadelprobe (Stigmaprobe) in kurkölnischen Hexenprozessen. Studien zur Kontroverse zwischen Peter Ostermann und Johannes Jordanaeus (1629-1630), in: Westfälische Zeitschrift 166 (2016), S. 213-266. - Text online unter: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/wz-11803.pdf.
III.5 Arbeitsfeld Religions-, Kirchen-, Theologie- und Liturgiegeschichte
A. Bücher:
Peter Arnold Heuser: Die Rostocker Theologen Quistorp des 17. und 18. Jahrhunderts im Spiegel ihrer Familienbibel. Kommentierte Edition einer Quelle zur Memorialkultur einer lutherischen 'Universitätsfamilie' der Frühen Neuzeit (= Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte, Bd. 33), Rostock 2021 (UNI Rostock: ISBN 978-3-86009-359-7; Herausgeber: Rektor der Universität Rostock; Redaktion: Kersten Krüger; 388 Seiten; http://d-nb.info/1240322429). Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Quistorp-Stiftung, Rostock, im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.; Geleitwort: Alexandra von der Wenge Gräfin Lambsdorff, geb. von Quistorp, als Vorsitzende des Kuratoriums der Quistorp-Stiftung, Rostock. - Elektronische Ressource (der Volltext ist kostenfrei zugänglich ohne Registrierung): https://doi.org/10.18453/rosdok_id00003108. - Eine textgleiche Printausgabe (ISBN 978-3-940835-68-0, 392 Seiten) für den Buchhandel ist am 27. September 2021 im ß-Verlag & Medien GbR, Rostock, erschienen. - S.oben Kap. II.1.
B. Aufsätze und Buchbeiträge:
Peter Arnold Heuser: Dabringhausen, ein bergischer Kirchort in Mittelalter und Früher Neuzeit – eine kirchengeschichtliche Skizze, in: Stadtjubiläum 2023. 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen (Wermelskirchen – Beiträge zu unserer Geschichte, Sonderband), Hg. vom Berg, Geschichtsverein, Abt. Wermelskirchen e.V., Bergisch Gladbach (Joh. Heider Verlag) 2023, S. 229–248, ISBN: 9783947779437.
Peter Arnold Heuser: Religion und Konfession als Dimensionen einer historischen Friedens- und Konfliktforschung - Anmerkungen zu einem ambivalenten Aspekt islamisch-christlicher Kulturbegegnung in Geschichte und Gegenwart, in: Peter Geiss, Peter Arnold Heuser, Michael Rohrschneider (Hgg.): Christen und Muslime in Mittelalter und Frühneuzeit. Ein Schlüsselthema des Geschichtsunterrichts im transepochalen Fokus (Wissenschaft und Lehrerbildung, Bd. 7), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht, Bonn University Press) 2022 (ISBN: 978-3-8471-1365-2; https://d-nb.info/1236110579. E-Book: ISBN: 978-3-8470-1365-5; ISBN: 978-3-7370-1365-9), S. 103-126.
Peter Arnold Heuser: Netzwerke des Humanismus im Rheinland: Georgius Cassander (1513-1566) und der jülich-klevische Territorienverbund, in: Guido von Büren, Ralf-Peter Fuchs und Georg Mölich (Hgg.): Herrschaft, Hof und Humanismus. Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg und seine Zeit (= Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie, Bd. 11), Bielefeld (Verlag für Regionalgeschichte) 2018 (2. Auflage 2020), S. 501-530.
Peter Arnold Heuser: Vom Augsburger Religionsfrieden (1555) zur konfessionellen Friedensordnung des Westfälischen Friedens (1648), in: Peter Geiss, Peter Arnold Heuser (Hgg.): Friedensordnungen in geschichtswissenschaftlicher und geschichtsdidaktischer Perspektive (Wissenschaft und Lehrerbildung, Bd. 2), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht, Bonn University Press) 2017 (ISBN: 978-3-8471-0671-5. E-Book: ISBN: 978-3-8470-0671-8. Als e-Book verfügbar unter https://doi.org/10.14220/9783737006712), S. 47-68.
Radevormwald - 700 Jahre Stadt, 1316-2016, herausgegeben vom Bergischen Geschichtsverein Abt. Radevormwald, Radevormwald 2016.
Darin:
- Peter Arnold Heuser: Zur Stadt- und Wirtschaftsgeschichte (um 1300-1618), in: Ebd., S. 21-34.
- Peter Arnold Heuser: Zur Kirchengeschichte (um 1300-1650), in: Ebd., S. 39-53.
siehe auch:
- Humanistische Irenik im 16. Jahrhundert und ihre Rezeption: s. oben Kap. III.2.
- Hexenjustiz im Kurfürstentum Köln (16.-18. Jahrhundert): s. oben Kap. III.3.
IV.
Auswahl Lehrveranstaltungen, Fortbildungen und Vorträge ab 2017
- Link zur Liste Lehrveranstaltungen.
- Sommersemester 2017: Universität Bonn, Institut für Geschichtswissenschaft (IGW), Übung (B.A./Lehramt: Epochenmodul Neuzeit): Einführung in die historische Bildanalyse / visual history (Beleg-Nr.: 504001621), Mi., 16-18 Uhr, IGW Raum I, Beginn: 19. April 2017.
- 1. Juli 2017: Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte: "Vivat pax. Lehren aus dem Westfälischen Frieden"; Beitrag zur Tagung: "Suche Frieden und jage ihm nach" (Ps. 34,15). Friedensvision - Friedensfähigkeit - Friedenskraft - Friedenspflicht. 45. Theologische Studientagung 2017 des Ansgar-Werkes der Bistümer Osnabrück, Hamburg und Münster für Priester, Diakone, Ordensleute und Laien in verantwortlichen Funktionen aus den skandinavischen Bistümern und Prälaturen, 26. Juni - 3. Juli 2017.
- 21. September 2017: Museen der Stadt Lüdenscheid, Vortrag: Die Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit im Kurfürstentum Köln (16.-18. Jahrhundert).
- 10. Oktober 2017: Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age (ACSGA); Golden Age Lecture: Diplomats as political publicists at the Westphalian Peace Congress (1643-1649).
- 16./17. November 2017, Haus der Geschichte Bonn, Tagung Christen und Muslime in Mittelalter und Frühneuzeit: Ein Schlüsselthema des Geschichtsunterrichts im interdisziplinären Fokus. Die Veranstalter sind (in Zusammenarbeit mit der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland): das Zentrum für Historische Friedensforschung der Universität Bonn (ZHF); die Abteilungen für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte der Universität Bonn, der Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte der Universität Bonn und das Institut für Islamwissenschaft der Universität Bonn.
- 6. Dezember 2017, Universität Bonn, Dies academicus (Panel des Centre for the Classical Tradition der Universität Bonn), Hörsaal V, 10.15 Uhr: "Augurium pacis" (1647) - Bildallegorien als Quellen zur Ideengeschichte des Friedens (Dr. Peter Arnold Heuser); 11.15 Uhr: Oskisches Bauerntheater zum Waffenstillstand von Ulm und eine geheimnisvolle prophetische Inschrift - zu Jacob Baldes "Poesis Osca sive Drama georgicum" (1647) (Alexander Winkler).
- Sommersemester 2018, Universität Bonn, Institut für Geschichtswissenschaft (IGW), Übung (B.A./Lehramt: Epochenmodul Neuzeit): Einführung in die historische Presseforschung, 1500-1800 (Beleg-Nr.: 504001810), Mi., 16-18 Uhr, IGW Raum I, Beginn: 11. April 2018.
- 8. November 2018, Familienbildungsstätte Ahlen - Katholisches Bildungsforum, Vortrag: Hexenverfolgung im geistlichen Staat (Kurs Nr. S7121-019).
- Sommersemester 2019, Universität Bonn, Institut für Geschichtswissenschaft (IGW), Übung (B.A./Lehramt: Modul Schlüsselqualifikationen): Bilder des Rechts - Recht und Justiz im Bild der europäischen Neuzeit (1500-1900) (Beleg-Nr.: 504002042), Di. 18-20 Uhr, IGW Raum I, Beginn: 2. April 2019.
- 11. März 2020, Kultur- und Stadthistorisches Museum Duisburg, Jahreshauptversammlung der Mercator-Gesellschaft, Vortrag: Gerhard Mercator (1512-1594) und Jean Matal (um 1517-1597). Facetten einer Beziehung.
- 2. Februar 2022, Universität Köln, Historisches Institut, Geschichte der Frühen Neuzeit; Vortrag: Hexenproben der Frühen Neuzeit im Kurfürstentum Köln als historische Erkenntnisquelle. Teil 1: Die Kaltwasserprobe = Gastvortrag im Hauptseminar Hexenverfolgungen zwischen Rhein und Ruhr (WiSe 2021/22; Prof. Dr. Gudrun Gersmann; Mi, 12:00–13:30 Uhr, Anna Maria von Schürmann-Raum = Raum 3.229).
- 31. Mai 2022, 17.15 Uhr, Kulturhistorisches Museum Rostock; Vortrag: „Familienuniversität“ der Frühen Neuzeit versus „Leistungsuniversität“ der Moderne? Die Rostocker Theologen Quistorp des 17. und 18. Jahrhunderts im Spiegel ihrer Familienbibel = Beitrag zur Vortragsreihe Kultur im Kloster, veranstaltet vom Arbeitskreis mediävistischer NachwuchswissenschaftlerInnen an der Universität Rostock und dem Kulturhistorischen Museum Rostock).
- 1. Juni 2022, Universitätsbibliothek Rostock; Workshop Materielle Kultur und Erinnerungskultur. Die Rostocker Theologen Quistorp des 17. und 18. Jahrhunderts im Spiegel ihrer Familienbibel von 1614/15. Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe Einführung in die Institutionen der Erinnerungskultur, welche die Universitätsbibliothek Rostock in Kooperation mit dem Universitätsarchiv Rostock und der Wossidlo-Forschungsstelle für Europäische Ethnologie durchführt, und Bestandteil des Blockseminars Spuren historischer Buchkultur in Mecklenburg-Vorpommern im SoSe 2022); Termin: Mittwoch, 1. Juni, 9:15 – 12:45 Uhr, Seminarraum im Erdgeschoss, Schwaansche Str. 3b.
- 24./25. Juni 2022, Universität Tübingen; Vortrag Die humanistische Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts als eine Inspirationsquelle für Wissenschaften und Künste. Studien zur Wirkungsgeschichte des Alciato-Schülers Jean Matal (um 1517–1597); Beitrag zum Workshop Humanistennetzwerke, veranstaltet im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts Intermedialität als Ansatzpunkt ästhetischer Reflexion in der niederländischen Druckgraphik der Frühen Neuzeit (Teilprojekt C04 des SFB 1391 Andere Ästhetik an der Universität Tübingen, unter der Leitung von Prof. Dr. Anna Pawlak, Kunstgeschichte und Prof. Dr. Anja Wolkenhauer, Latinistik).
- 29. Juni 2022: Universität Köln, Historisches Institut, Geschichte der Frühen Neuzeit. Vortrag Hexenproben der Frühen Neuzeit im Kurfürstentum Köln als historische Erkenntnisquelle. Teil 2: Die Nadel- oder Stigmaprobe = Gastvortrag im Hauptseminar Wasserproben, Hexenprozesse, adlige Hexenpolitik: Das Beispiel Westfalen (SoSe 2022; Prof. Dr. Gudrun Gersmann; Mi, 12:00–13:30 Uhr, Anna Maria von Schürmann-Raum = Raum 3.229).
- 7./8. Juli 2022, Rinteln; Vortrag Die Universität Rinteln und die Hexenverfolgung. Beitrag zur Tagung 400 Jahre Universität Rinteln, veranstaltet von der Historischen Arbeitsgemeinschaft für Schaumburg und der Universität Göttingen (Prof. Dr. Marian Füssel) in Verbindung mit der Stadt Rinteln, gefördert durch die Schaumburger Landschaft und das Niedersächsische Landesarchiv. Vorbereitung und Organisation: Dr. Stefan Brüdermann.
- 14. – 17. September 2022, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tagungshaus Weingarten. Vortrag Hexenjustiz im Kurfürstentum Köln. Konjunkturen, Strukturen und Akteure; Beitrag zur Tagung Hexen im Heiligen Reich. Die Hexenverfolgung in Geistlichen Territorien. Tagung des Arbeitskreises Interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH) und der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Veranstalter: Prof. Dr. Wolfgang Behringer (Saarbrücken), Prof. Dr. Gerd Schwerhoff (Dresden), Dr. Rita Voltmer (Trier).
- 14. Dezember 2022: Universität Köln, Historisches Institut, Geschichte der Frühen Neuzeit. Vortrag Dämonologie vor Ort - Dämonologie im Wandel. Zur Diachronie lokaler Diskurse über Zauberei und Hexerei in der Reichsherrschaft Wildenburg an der Sieg und der kurkölnischen Unterherrschaft Schönstein an der Sieg vom frühen 16. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts = Gastvortrag im Hauptseminar Die Hexenverfolgungen im gelehrten Diskurs der Frühen Neuzeit: Befürworter und Gegner (WiSe 2022/23; Prof. Dr. Gudrun Gersmann; Mi, 12:00–13:30 Uhr, Anna Maria von Schürmann-Raum = Raum 3.229).
- 15. Dezember 2022, Siegen; Vortrag Hexenjustiz im Kurfürstentum Köln. Konjunkturen, Strukturen und Akteure; Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe Siegener Forum (in Kooperation zwischen dem Stadtarchiv Siegen, der Volkshochschule Siegen, der Geschichtswerkstatt Siegen e.V., dem Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein e.V. sowie dem Aktiven Museum Südwestfalen e.V.); Beginn: 18.30 Uhr, im Atriumsaal der Siegerlandhalle.
- 7. November 2023: Universität Köln, Historisches Institut, Geschichte der Frühen Neuzeit. Vortrag: "Hexenbischöfe" - Zur Dekonstruktion eines populären Narrativs. Denkanstöße unter besonderer Berücksichtigung des Kurfürstentums Köln in der Frühen Neuzeit = Gastvortrag im Hauptseminar Hexenverfolgungen und Erinnerungskultur (WiSe 2023/24; Prof. Dr. Gudrun Gersmann; Di., 14.00–16.00 Uhr, Anna Maria von Schürmann-Raum = Raum 3.229).
- 20. November 2023, Münster; Vortrag Neue pressehistorische Perspektiven auf den Westfälischen Friedenskongress 1643-1649; Veranstaltung des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster e.V., aus Anlass des Gedenkjahres 375 Jahre Westfälischer Frieden (1648-2023); Beginn: 19.00 Uhr, im Plenarsaal des Landeshauses Münster (Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48147 Münster). Link: https://www.youtube.com/watch?v=ovAWdvz4Cw4.
- 27.-29. Juni 2024, Lutherstadt Wittenberg: Tagung Universität und Familie. Gelehrtenfamilien, Stipendienwesen, Berufungspolitik und soziale Praktiken im Alten Reich (16.-18. Jahrhundert); in Kooperation mit Matthias Asche (Potsdam), Patrick Schiele (Frankfurt am Main) und der Stiftung LEUCOREA. Tagungsort ist das Tagungszentrum der LEUCOREA, Stiftung des öffentlichen Rechts an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in den Räumen der alten Universität Wittenberg. Link: https://www.hsozkult.de/event/id/event-144732.
- 3. Dezember 2024, Universität Köln, Historisches Institut, Geschichte der Frühen Neuzeit; Vortrag: Zwischen Ordalienmentalität und experimentellem Denken. Zur Wasserprobe in kurkölnischen Hexenprozessen der Frühen Neuzeit. – Gastvortrag bei Prof. Dr. Gudrun Gersmann (12.00 Uhr, Anna Maria von Schürmann-Raum = Raum 3.229).
- 16. Januar 2025, Universität Bonn, CCT – Centre for the Classical Tradition, WiSe 2024, Reihe: Atelier Antikerezeption; Donnerstag, 18.15 Uhr, Rabinstraße 8, Seminarraum 11, Vortrag: Jean Matal (um 1517 – 1597): Gelegenheitsdichtungen: Bestandsaufnahme – Themenfelder – Historische Einordnung.
- 14. Oktober 2025, Vortrag: Zwischen Ordalienmentalität und experimentellem Denken. Hexenproben (Wasserprobe, Stigmaprobe) im frühneuzeitlichen Kurfürstentum Köln als historische Erkenntnisquellen. Veranstalter: Wissenschaftlicher Verein Mönchengladbach, Dienstag, 14. Oktober 2025, 19.00 – 21.00 Uhr. Ort: Haus Erholung, Johann-Peter-Bölling-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
- 28. Oktober 2025, Vortrag: Hexenjustiz im Kurfürstentum Köln. Konjunkturen, Strukturen und Akteure. Veranstalter: VHS Datteln, Dienstag, 28. Oktober 2025. Ort: Bücherei Bücherwurm, Datteln, 19.00 Uhr – 21 Uhr.


.jpg/picture-200?_=18655834da6)
.jpg/picture-200?_=186557996d5)